Shownotes auf http://www.EvolutionRadioShow.de/220
Kanal abonnieren https://paleolc.com/YouTube
Podcast https://itunes.apple.com/de/podcast/e...
---
In dieser fesselnden Episode unseres Science Taks schauen wir uns die "Protein Leverage Hypothese" an und entdecken, warum Protein so viel mehr ist als nur ein Makronährstoff. Du erfährst, wie Proteine dein Sättigungsgefühl beeinflussen, dein Gewichtsmanagement verbessern und dein Essverhalten steuern können.
Ess-Wissen Club für Praktiker - Dein Schlüssel zu aktuellem Ernährungswissen und Vorlagen für die Praxis
Bleibst Du gerne auf dem Laufenden, ohne in Studienbergen zu versinken? Der EWiP-Club ist Deine Lösung! Wir filtern, übersetzen und kondensieren die neuesten Ernährungserkenntnisse direkt auf Deinen Schreibtisch - in deutscher Sprache und praxisnah aufbereitet.
14 Tage ohne Risiko testen. Rabatt-Code PODCAST10 und du bekommst 10% auf die Jahresmitgliedschaft.
https://esswissen-club.com/
Kapitel
00:00 Das erwartet dich in der Episode
01:44 EssWissen Club für Praktiker
03:04 Begrüßung und Einleitung
06:04 Proteinhebel-Hypothese
10:24 Proteindichte in Lebensmitteln
11:36 Proteindichte und Nahrungsaufnahme
12:16 Natürliche Sättigung - wir essen bis alle Aminosäuren gedeckt sind
15:45 Ultra Processed Food - Hochverarbeitete Lebensmittel
20:08 Zusammenfassung
25:25 Was ist der EssWissen Club
Wir sprechen über
Die Protein Leverage Hypothese ist ein interessantes Konzept aus der Ernährungswissenschaft, das erklärt, wie und warum der Proteingehalt in unserer Nahrung unser Essverhalten beeinflussen kann. Diese Hypothese wurde von den Forschern Raubenheimer und Simpson entwickelt und beruht auf der Beobachtung, dass Tiere – einschließlich Menschen – dazu neigen, eine konstante Menge an Protein zu konsumieren, unabhängig von der Aufnahme anderer Nährstoffe wie Fette und Kohlenhydrate.
Hier die Grundprinzipien der Protein Leverage Hypothese:
Konstantes Proteinziel: Der Körper strebt danach, eine bestimmte Menge an Protein zu erreichen. Wenn die Nahrung proteinreich ist, erreicht man dieses Ziel mit weniger Gesamtkalorienaufnahme. Ist die Nahrung jedoch proteinarm, tendieren Menschen dazu, mehr zu essen, um das notwendige Protein zu bekommen.
Kalorienaufnahme und Gewichtsmanagement: Wenn die Proteindichte in der Nahrung niedrig ist, kann das zu einer übermäßigen Kalorienaufnahme führen, da der Körper weiterhin nach dem Proteinziel strebt. Dies kann zur Gewichtszunahme beitragen, da man mehr isst, um den Proteinbedarf zu decken.
Einfluss auf die Nahrungsauswahl: Diese Hypothese erklärt auch, warum Menschen dazu neigen, sich für Nahrungsmittel zu entscheiden, die ihr Proteinziel schneller erreichen lassen. Dies hat wichtige Implikationen für die Ernährungspolitik und die Formulierung von Empfehlungen zur öffentlichen Gesundheit.
Die Protein Leverage Hypothese hilft, zu verstehen, warum eine ausgewogene Ernährung wichtig ist und warum proteinreiche Diäten oft beim Gewichtsmanagement effektiver sein können. Sie zeigt auf, dass nicht nur die Menge der aufgenommenen Kalorien, sondern auch die Nährstoffzusammensetzung der Nahrung entscheidend für gesundes Essverhalten und Gewichtskontrolle ist.
Alles über Ulrike Gonder und Julia Tulipan
Über Ulrike Gonder: Dipl. oec. troph. und Freie Wissenschaftsjournalistin https://ulrikegonder.de/
Über Julia Tulipan: Magister der Biologie und Master klinische Ernährungsmedizin https://juliatulipan.com/
Relevante Artikel
Raubenheimer, David, and Stephen J. Simpson. "Protein appetite as an integrator in the obesity system: the protein leverage hypothesis." Philosophical Transactions of the Royal Society B 378.1888 (2023): 20220212.
Willems, Anouk EM, et al. "Effects of macronutrient intake in obesity: a meta-analysis of low-carbohydrate and low-fat diets on markers of the metabolic syndrome." Nutrition reviews 79.4 (2021): 429-444.
Edmonds, M. S., and D. H. Baker. "Amino acid excesses for young pigs: effects of excess methionine, tryptophan, threonine or leucine." Journal of Animal Science 64.6 (1987): 1664-1671.
---
Bitte beachten Sie auch immer den aktuellen
"Haftungsausschluss (Disclaimer) und allgemeiner Hinweis zu medizinischen Themen" auf https://juliatulipan.com/haftungsauss...


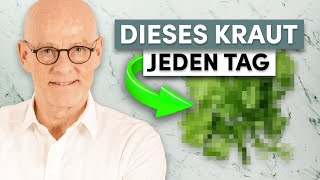







Информация по комментариям в разработке